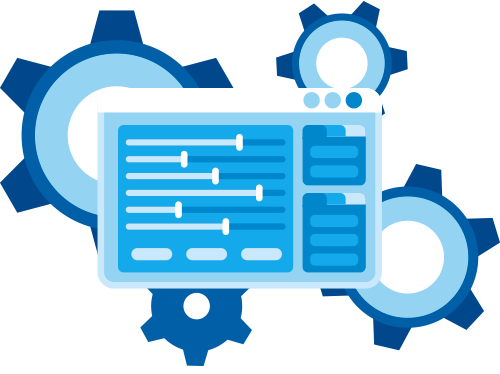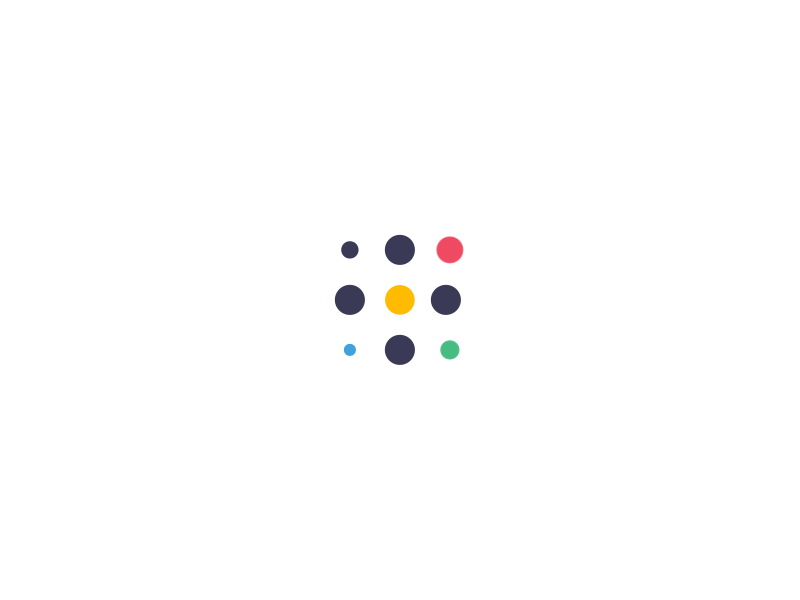Lithium: Rohstoff mit politischer Sprengkraft
- Kommentare deaktiviert für Lithium: Rohstoff mit politischer Sprengkraft
- Allgemein
Michael Schmidt ist einer der profiliertesten Rohstoffexperten Deutschlands – insbesondere, wenn es um Lithium und andere für die Energiewende unverzichtbare Metalle geht. Als Diplom-Geologe bei der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) innerhalb der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) analysiert er seit vielen Jahren globale Lieferketten, bewertet Versorgungsrisiken und berät Industrie wie Politik in strategischen Fragen.
Lithium steht dabei besonders im Fokus: Kein anderer Rohstoff ist so stark mit der Elektromobilität, der Energiespeicherung und der geopolitischen Neuordnung internationaler Handelsbeziehungen verknüpft.
Im Gespräch mit Elektroauto-News ordnet Schmidt die aktuelle Lage ein – sachlich, kenntnisreich und mit Blick auf das große Ganze. Er erklärt, warum Lithium auf absehbare Zeit nicht zu ersetzen ist, wie sehr Europa bei Förderung und Weiterverarbeitung vom Rest der Welt – insbesondere von China – abhängig ist, und welche Fehler man in der Vergangenheit gemacht hat. Vor allem aber zeigt er auf, welche Chancen sich noch bieten, wenn Politik, Industrie und Gesellschaft jetzt entschlossen handeln.
Sebastian Henßler, Elektroauto-News: Herr Schmidt, warum ist Lithium so entscheidend für die Mobilitäts- und Energiewende?
Michael Schmidt: Lithium spielt eine Schlüsselrolle, weil es in allen heute gängigen Batterietechnologien enthalten ist – und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht grundlegend ändern. Aufgrund seiner besonderen physikochemischen Eigenschaften ist es derzeit schlichtweg nicht zu ersetzen. Es ist das leichteste Metall, besitzt eine hohe elektrochemische Potenzialdifferenz und ermöglicht damit eine hohe Energiedichte – genau das, was wir für mobile wie stationäre Anwendungen brauchen.
Dabei geht es längst nicht nur um Elektroautos, auch wenn diese im Zentrum der öffentlichen Debatte stehen. Lithium ist ebenso unverzichtbar für stationäre Batteriespeicher, die notwendig sind, um Strom aus Wind- und Solaranlagen zwischenzuspeichern und Netze zu stabilisieren – insbesondere in einer Energieinfrastruktur, die immer stärker auf fluktuierende, erneuerbare Quellen setzt. Dieser Bedarf wird weiter steigen, insbesondere im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung von Industrie und Gebäuden.
Ein zusätzlicher und oft unterschätzter Treiber ist der stark wachsende Strombedarf durch Künstliche Intelligenz. Rechenzentren, die große Sprachmodelle wie ChatGPT betreiben oder Videoinhalte bereitstellen, benötigen riesige Mengen Energie – und damit zunehmend auch Batteriespeicher zur Netzstabilisierung oder Notstromversorgung. Wir sehen dort bereits Wachstumsraten von 40 Prozent jährlich beim Bedarf an Speicherlösungen, in denen wiederum Lithium steckt.
Kurz gesagt: Lithium ist nicht nur der Rohstoff der E-Mobilität, sondern auch der Grundpfeiler einer modernen, elektrifizierten Welt. Ohne dieses Element lässt sich weder die Mobilitätswende noch die Energiewende glaubhaft umsetzen. Und wer an eine resiliente, klimaneutrale Energiezukunft glaubt, kommt an Lithium – zumindest in den nächsten ein bis zwei Dekaden – nicht vorbei.
Sie haben die politische Dimension angesprochen. Inwiefern beeinflussen politische Vorgaben die Bedeutung von Lithium?
Die Bedeutung von Lithium ist in Europa in hohem Maße politisch geprägt. Anders als in manchen anderen Weltregionen, in denen technologische Entwicklungen oder Marktmechanismen die Transformation vorantreiben, ist der Wandel hin zur Elektromobilität hierzulande überwiegend regulatorisch initiiert – also ein klassischer Top-down-Prozess. Es handelt sich weniger um eine natürliche Marktdynamik, bei der Konsument:innen den Wandel aktiv einfordern. Vielmehr erleben wir eine politisch forcierte Entwicklung mit klaren Zielvorgaben, etwa dem geplanten Auslauf neuer Fahrzeuge, die CO₂-Emissionen verursachen, ab 2035.
Auch wenn diese Vorgaben aktuell stellenweise wieder in Frage gestellt oder abgeschwächt werden, bleibt die grundsätzliche Richtung bestehen: weg vom fossilen Verbrenner, hin zu emissionsfreier Mobilität. Und mit dieser Richtung wächst der Bedarf an Lithium zwangsläufig. Denn solange kein technologisch gleichwertiger Ersatzstoff verfügbar ist – was aktuell nicht absehbar ist –, ist Lithium für alle seriösen Mobilitäts- und Energieszenarien gesetzt. Insofern hängt die strategische Relevanz von Lithium direkt mit der politischen Rahmensetzung zusammen.
Hinzu kommt eine zunehmend brisante geopolitische Lage. Denn Lithium ist nicht nur ein Rohstoff, sondern mittlerweile ein strategisches Gut. China kontrolliert nicht nur große Teile der Rohstoffverarbeitung, sondern ist auch im Bereich der Batterieproduktion, der Zellchemie und der Downstream-Wertschöpfungskette führend. Diese starke Abhängigkeit von einem einzelnen Akteur in zentralen Gliedern der Lieferkette ist hochriskant – ökonomisch wie sicherheitspolitisch. Deshalb sprechen viele inzwischen von einer politischen Geologie: Die Frage, wo ein Rohstoff vorkommt und von wem er kontrolliert wird, ist längst Teil einer machtpolitischen Debatte geworden.
All das macht Lithium nicht nur zu einem entscheidenden Baustein der Energiewende, sondern auch zu einem Gradmesser für Europas wirtschaftliche und technologische Souveränität. Der Umgang mit diesem Rohstoff ist deshalb nicht allein eine Frage der Industriepolitik – sondern auch eine Frage strategischer Resilienz.
Wie schätzen Sie die künftige Nachfrage ein?
Die Nachfrage nach Lithium wird in den kommenden Jahren exponentiell wachsen – und zwar deutlich breiter getrieben, als man das noch vor wenigen Jahren angenommen hat. Lange Zeit galt der Pkw-Sektor als Hauptverursacher des Lithiumbedarfs, und natürlich bleibt die Elektromobilität ein zentrales Wachstumsfeld. Aber das Bild hat sich erweitert – sowohl technologisch als auch geografisch.
Ein stark wachsender Bereich ist der schwere Nutzfahrzeugsektor: Lkw und Busse, die früher noch als Domäne des Wasserstoffantriebs galten, werden zunehmend batterieelektrisch geplant. Der Fokus verschiebt sich, weil Batterietechnologien – insbesondere auf Basis von Lithium – mittlerweile als effizienter, kostengünstiger und schneller einsetzbar gelten. Hinzu kommen stationäre Energiespeicher, die für die Zwischenspeicherung von Wind- und Solarstrom unerlässlich sind. Ohne leistungsfähige Speichertechnologie lassen sich erneuerbare Energien nicht zuverlässig ins Netz integrieren. Gerade in Regionen mit großen Distanzen zwischen Energieerzeugung und Verbrauch – etwa in Chile – entstehen neue, dezentrale Speicherlösungen.
Besonders dynamisch – und noch stark unterschätzt – ist der Bedarf durch den globalen Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Strombedarf dieser Datencenter ist immens, und der Bedarf an unterbrechungsfreier Energieversorgung wächst entsprechend. Diese Nachfrage ist nicht nur quantitativ eine Herausforderung, sondern auch qualitativ: Sie verteilt sich zunehmend über verschiedene Sektoren mit unterschiedlichen Anforderungen an Zyklenfestigkeit, Leistungsdichte oder Temperaturstabilität. Das bedeutet, dass wir künftig mit einer Vielzahl spezialisierter Batterielösungen rechnen müssen – aber nahezu alle auf Lithiumbasis.
In Summe zeigt sich: Der globale Bedarf an Lithium ist nicht nur größer, sondern auch vielfältiger als noch vor wenigen Jahren angenommen. Diese Entwicklung wurde lange unterschätzt – aber sie ist längst Realität. Und sie stellt die gesamte Wertschöpfungskette, vom Bergbau über die Raffination bis zur Batterieproduktion, vor gewaltige Herausforderungen.
Mit der steigenden Nachfrage wächst auch die öffentliche Aufmerksamkeit – oft verbunden mit Kritik. Lithium steht regelmäßig in der Kritik: hoher Wasserverbrauch, Umweltbelastung, soziale Konflikte. Wie berechtigt sind diese Vorwürfe?
Der Diskurs rund um Lithium ist oft stark emotionalisiert – und das macht es schwierig, sachlich über die tatsächlichen Auswirkungen zu sprechen. Klar ist: Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur. Die entscheidende Frage ist aber, wie dieser Eingriff gestaltet wird. Es gibt große Unterschiede – sowohl bei den Fördermethoden als auch bei den daraus resultierenden Umweltfolgen.
Rund die Hälfte des weltweiten Lithiumangebots stammt heute aus zwei sehr unterschiedlichen Quellen: zum einen aus den bekannten Salzseen in Südamerika, etwa in Chile, zum anderen aus Hartgesteinsvorkommen, etwa in Australien. Und genau diese Prozessroute macht einen enormen Unterschied. In Chile wird das Lithium durch Verdunstung gewonnen, wobei ein großer Teil des Prozesses mit Sonnenenergie abläuft – entsprechend gering ist der Energieeinsatz.
Lithium-Gewinnung bei SQM in Chile / Bild: Sebastian Henßler
Der CO₂-Fußabdruck liegt hier bei etwa fünf Tonnen pro Tonne Lithiumcarbonat. Ganz anders sieht es bei australischem Hartgestein aus: Dieses muss im Tagebau gewonnen, anschließend zu Konzentrat verarbeitet, nach China verschifft und dort unter hohem Energieeinsatz bei über 1000 Grad weiterverarbeitet werden. Am Ende steht ein CO₂-Fußabdruck von 20 Tonnen – und bei bestimmten Projekten in China sogar bis zu 60 Tonnen pro Tonne Lithiumcarbonat.
Dazu kommt: Beim Hartgestein entstehen große Mengen Abfall – etwa 100.000 Tonnen Rückstände pro 10.000 Tonnen Lithiumprodukt. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Herkunft und die Produktionsroute eines Rohstoffs mitzudenken. Es geht also nicht nur um die Frage ob, sondern wo und wie wir Lithium fördern. Denn das bestimmt maßgeblich den ökologischen Fußabdruck – und letztlich auch die Glaubwürdigkeit der Energiewende.
Sie sprechen vom „CO₂-Preisschild“ von Produkten. Wie können Unternehmen konkret darauf reagieren?
Der CO₂-Fußabdruck eines Produkts ist längst mehr als nur ein abstrakter Umweltindikator – er wird zunehmend zu einem echten Wettbewerbsfaktor. Wenn wir etwa über E-Autos sprechen, reicht es nicht, die Emissionen im Betrieb zu betrachten. Auch die Rohstoffe, aus denen Batterien gefertigt werden, hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck – und der kann sich je nach Herkunft dramatisch unterscheiden.
Unternehmen haben hier mehrere Stellschrauben. Der wichtigste Hebel ist die Auswahl ihrer Rohstoffquellen und Lieferanten. Wer etwa auf Lithium aus Chile setzt, dessen Produkt verursacht deutlich weniger CO₂-Emissionen als bei Lithium, das über Australien und China verarbeitet wird. Der Unterschied liegt im Extremfall beim Faktor 10. Das kann, wenn man es durch die Batteriegröße eines Fahrzeugs rechnet, schnell zu einem echten Unterschied in der Gesamtbilanz führen.
Zugleich gewinnen Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette an Bedeutung. Unternehmen können und sollten künftig dokumentieren, woher ihre Rohstoffe stammen, wie sie verarbeitet wurden und welchen ökologischen und sozialen Standards sie dabei unterlagen. Das ermöglicht nicht nur mehr Transparenz gegenüber den Kund:innen, sondern stärkt auch die eigene Position im Wettbewerb – insbesondere, wenn politische Mechanismen wie der CO₂-Grenzausgleich (CBAM) greifen oder verpflichtende Nachhaltigkeitsberichte eingeführt werden.
Aber: Mehr Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Wer klimafreundlichere Rohstoffpfade wählt, wird in der Regel höhere Produktionskosten haben – etwa weil saubere Prozesse aufwendiger oder nicht so stark subventioniert sind. Deshalb stellt sich am Ende immer auch die Frage: Wer trägt diese Mehrkosten? Der Hersteller? Der Kunde? Oder wird ein Teil davon politisch abgefedert?
Strategische Unabhängigkeit bedeutet also auch höhere Kosten. Wer sollte Ihrer Meinung nach diese Mehrkosten tragen – Industrie, Verbraucher oder der Staat?
Das ist die entscheidende Frage – und sie ist alles andere als trivial. Denn strategische Souveränität gibt es nicht zum Nulltarif. Wer sich aus einseitigen Abhängigkeiten befreien will, wer sichere, nachvollziehbare und nachhaltigere Lieferketten aufbauen möchte, muss bereit sein, dafür zu investieren. Das betrifft nicht nur die Industrie, sondern am Ende auch uns alle als Konsument:innen – und nicht zuletzt den Staat als politisch gestaltende Instanz.
In der Realität heißt das oft: Entweder die Industrie trägt die höheren Kosten und gibt sie an die Verbraucher weiter – oder die Politik muss gezielt gegensteuern, etwa über Förderprogramme, Grenzausgleichsmechanismen oder staatliche Beteiligungen. Fakt ist: Wenn wir in Europa nicht bereit sind, für Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit zu zahlen, werden wir weiterhin auf externe Lieferanten angewiesen bleiben – mit allen Risiken, die das langfristig mit sich bringt.
Eine Lithium-Mine von Allkem Livent in Australien / Shutterstock 2161877315
Insofern lautet die zentrale Frage nicht nur: Wer bezahlt die Rechnung?, sondern auch: Was ist uns Rohstoffsouveränität wert? Und sind wir bereit, heute mehr zu investieren, um morgen nicht politisch und wirtschaftlich erpressbar zu sein? Diese Diskussion muss geführt werden – offen, ehrlich und jenseits von ideologischen Grabenkämpfen.
Wie versucht Europa auf diese Abhängigkeiten zu reagieren? Ist der Critical Raw Materials Act die richtige Antwort?
Der Critical Raw Materials Act (CRMA) ist ein längst überfälliger Schritt – und ein klares politisches Signal, dass Europa die Rohstofffrage als strategisches Thema erkannt hat. Mit dem Gesetz hat die EU erstmals verbindliche Zielwerte formuliert: Bis 2030 sollen zehn Prozent des Bedarfs an ausgewählten kritischen Rohstoffen – darunter Lithium – aus heimischem Bergbau stammen, 40 Prozent in Europa weiterverarbeitet werden und maximal 65 Prozent aus einem einzelnen Drittstaat importiert werden. Außerdem sollen 25 Prozent des Bedarfs durch Recycling gedeckt werden.
Das klingt ambitioniert – und ist es auch. Aber vieles davon ist realistisch nur erreichbar, wenn wir heute konsequent handeln. Ein großes Problem ist der Faktor Zeit: Der Aufbau neuer Bergbauprojekte dauert in Europa im Schnitt zehn bis fünfzehn Jahre – also länger als der Zeithorizont, den der CRMA vorgibt. Zwar gibt es bereits rund 15 bis 16 Lithiumprojekte in Europa, aber kaum eines davon ist bislang produktionsreif. Viele davon werden auch gar nicht bis 2030 realisiert – sei es aus wirtschaftlichen, genehmigungsrechtlichen oder gesellschaftspolitischen Gründen. Denn mit dem Willen auf EU-Ebene allein ist es nicht getan: Es braucht Investitionen, gesellschaftliche Akzeptanz und einen regulatorischen Rahmen, der Projekte auch wirklich möglich macht.
Bei der Weiterverarbeitung – also etwa der Raffination zu Lithiumhydroxid – wird es noch schwieriger. Hohe Energiepreise, strengere Umweltauflagen und fehlende Infrastruktur machen den Standort Europa im globalen Vergleich wenig attraktiv. Und beim Recycling gilt: Die meisten Batterien, die heute im Umlauf sind, werden erst nach 2030 zurückkommen – ein nennenswerter Beitrag zur Rohstoffversorgung ist also kurzfristig nicht zu erwarten.
Trotzdem ist der CRMA wichtig. Denn er schafft erstmals verbindliche Leitplanken, nach denen Industrie, Investoren und Mitgliedsstaaten sich ausrichten können. Er zeigt: Die Rohstofffrage ist kein rein technisches oder ökonomisches Thema mehr – sie ist eine Frage europäischer Resilienz und Handlungsfähigkeit. Aber es reicht nicht, den Act zu verabschieden – er muss auch mit Leben gefüllt werden. Sonst bleibt er Symbolpolitik.
Europa möchte unabhängiger werden – aber gibt es hier überhaupt genug Lithium? Und woran scheitert es bislang, diese Projekte umzusetzen?
Ja, Europa verfügt durchaus über relevante Lithiumvorkommen. In Ländern wie Portugal, Spanien, Deutschland, Ukraine, Tschechien, Serbien oder Finnland gibt es Projekte, die grundsätzlich dazu beitragen könnten, den europäischen Bedarf zumindest anteilig zu decken. Nach aktuellem Stand ließe sich damit bis 2030 etwa ein Viertel bis ein Drittel des erwarteten Lithiumbedarfs in Europa aus heimischen Quellen abdecken – das ist mehr als die im CRMA gesetzten zehn Prozent für den Bergbau. Rein geologisch betrachtet ist das Potenzial also vorhanden.
Aber zwischen Lagerstätte und marktfähigem Produkt liegt ein langer Weg – und genau hier beginnen die Probleme. Der Aufbau eines Lithiumprojekts in Europa dauert im Schnitt zehn bis fünfzehn Jahre. Das liegt nicht nur an den komplexen Genehmigungsverfahren, sondern auch an gesellschaftlicher Ablehnung, Investitionshürden und fehlender Erfahrung im metallischen Bergbau. Denn viele der Projekte werden nicht von europäischen Unternehmen entwickelt, sondern von kanadischen, australischen oder britischen Explorationsfirmen. In Europa selbst gibt es kaum noch Investor:innen, die bereit sind, in rohstoffnahe Projekte zu gehen – das Risikobewusstsein ist da, aber nicht die Risikobereitschaft.
Dazu kommt: Der industrielle Unterbau fehlt vielerorts. Es mangelt an Erfahrungen im Projektmanagement, an gut ausgebildetem Personal für Exploration, Aufbereitung und Betrieb – und nicht zuletzt an der gesellschaftlichen Akzeptanz. In einer Region wie dem Erzgebirge, die jahrhundertelang vom Bergbau geprägt war, stehen heute direkt hinter dem Ortsschild Protestschilder gegen neue Projekte. Der Wille, unabhängig zu werden, ist auf europäischer Ebene zwar formuliert – aber lokal fehlt oft die Bereitschaft, die dafür nötigen Schritte auch mitzutragen.
Kurz gesagt: Europa könnte deutlich mehr Lithium selbst fördern. Aber damit das Realität wird, braucht es mehr als Gesetze – nämlich gezielte Investitionen, schnellere Genehmigungsverfahren, öffentliche Akzeptanz und das Verständnis, dass strategische Souveränität mit strukturellem Wandel verbunden ist.
Wie steht Europa im globalen Vergleich da, insbesondere im Vergleich zu China?
Kurz gesagt: Europa hinkt hinterher – in fast allen relevanten Bereichen entlang der Lithium-Wertschöpfungskette. Während die EU gerade erst versucht, durch den Critical Raw Materials Act erste eigene Kapazitäten aufzubauen, hat China über Jahre hinweg gezielt vorinvestiert – und sich damit eine dominante Stellung erarbeitet. Diese umfasst nicht nur den Zugang zu Rohstoffen, sondern auch die nachgelagerten Verarbeitungs- und Fertigungsstufen.
China kontrolliert heute rund 60 bis 70 Prozent der globalen Raffinierungskapazitäten für Lithium und dominiert den Markt für Lithiumhydroxid – der zentralen Vorstufe für Batteriezellen. Das Rohmaterial dafür stammt oft aus Australien, wird aber fast ausschließlich in China weiterverarbeitet. Selbst die wenigen Alternativen – etwa neue Projekte in Afrika oder Südamerika – sind häufig über Beteiligungen oder langfristige Abnahmeverträge mit chinesischen Unternehmen abgesichert. In Ländern wie dem Kongo, Namibia oder Mosambik sind chinesische Player schon lange aktiv, während europäische Unternehmen dort aus Compliance- oder Risikogründen oft zögern.
Hinzu kommt: China ist nicht nur bei der Verarbeitung stark, sondern auch bei der Zellproduktion, der Batterieentwicklung und zunehmend sogar bei kompletten Elektroautos. Ziel ist klar: Nicht mehr nur Rohstoffe und Vorprodukte zu verkaufen, sondern die gesamte Wertschöpfungskette selbst zu besetzen. Europa dagegen steht vielerorts erst am Anfang – mit ersten Pilotanlagen, hohem Investitionsbedarf
China ist international extrem gut vernetzt – muss Europa beim Lithium-Import neue Allianzen schmieden, um nicht abgehängt zu werden?
Unbedingt. China hat in den vergangenen Jahren systematisch globale Partnerschaften aufgebaut – mit Ländern, in denen europäische Unternehmen aus politischen, wirtschaftlichen oder ethischen Gründen oft zögern. Gerade im südlichen Afrika, in Teilen Südamerikas und auch in Asien sind chinesische Unternehmen längst präsent: Sie investieren früh, sichern sich langfristige Lieferverträge, beteiligen sich an Minen oder bauen gleich ganze Verarbeitungsanlagen. Diese Tiefe der Integration verschafft ihnen einen strategischen Vorteil, den Europa derzeit nicht hat.
Europa hingegen steht vor der Herausforderung, aus einer nahezu vollständigen Importabhängigkeit heraus zu handeln – und das unter wachsendem Zeitdruck. Eine Diversifizierung der Lieferländer ist daher alternativlos. Es braucht neue strategische Allianzen – mit verlässlichen Partnern, die politisch stabil sind, ähnliche Werte teilen und langfristig an faire Zusammenarbeit interessiert sind. Chile ist hier ein gutes Beispiel: Das Land verfügt nicht nur über große Lithiumreserven, sondern verfolgt auch eine nationale Strategie, die auf mehr lokale Wertschöpfung und Kooperation statt Ausverkauf setzt. Für europäische Unternehmen bietet das die Chance, nicht nur Rohstoffe zu importieren, sondern gemeinsam mit Partnern in nachhaltige Projekte zu investieren.
Solche Partnerschaften erfordern jedoch ein Umdenken: Weg von kurzfristigem Rohstoffhandel, hin zu einer kooperativen, industriepolitisch unterstützten Zusammenarbeit – inklusive Technologietransfer, Ausbildungsprogrammen oder Beteiligungsmodellen. Nur so kann Europa auf Augenhöhe mit Ländern wie China agieren – und zugleich dafür sorgen, dass der Rohstoffabbau auch für die Herkunftsländer echten Mehrwert schafft.
Gleichzeitig sollten auch bilaterale Regierungsabkommen – etwa mit Kanada, Australien oder Ländern in Südamerika – stärker genutzt werden. In vielen Fällen gibt es bereits diplomatische Grundlagen, aber die wirtschaftliche Umsetzung bleibt zögerlich. Hier braucht es mehr Mut, Tempo und strategisches Denken. Denn die Zeit, in der sich Europa auf offene Weltmärkte verlassen konnte, ist vorbei. Wer Rohstoffe wie Lithium künftig zuverlässig beziehen will, braucht belastbare Allianzen – nicht nur auf dem Papier, sondern mit realer wirtschaftlicher Substanz.
Was müsste jetzt konkret passieren, damit Europa beim Thema Lithium nicht weiter ins Hintertreffen gerät?
Vor allem eins: Wir müssen aufhören, uns in Detaildebatten zu verlieren – und endlich ins Handeln kommen. Europa hat das Thema Lithium lange unterschätzt. Jetzt ist die Zeit knapp – aber es ist noch nicht zu spät. Was es braucht, ist ein Zusammenspiel aus klaren politischen Leitplanken, industriepolitischem Mut, gezielten Investitionen und gesellschaftlichem Rückhalt.
Politisch heißt das: Die Zielvorgaben aus dem Critical Raw Materials Act müssen jetzt zügig mit konkreten Maßnahmen unterfüttert werden – etwa durch vereinfachte Genehmigungsverfahren, schnellere Behördenprozesse und gezielte Förderinstrumente für europäische Rohstoff- und Verarbeitungsvorhaben. Parallel dazu müssen wir als Gesellschaft akzeptieren, dass Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen, auch irgendwo gewonnen werden müssen – idealerweise unter den hohen Umwelt- und Sozialstandards, die wir in Europa setzen können.
Industrieseitig braucht es mehr Bereitschaft zur strategischen Kooperation – mit Rohstoffunternehmen, mit Zellherstellern, mit internationalen Partnern. Und nicht zuletzt müssen wir das Thema Kommunikation ernst nehmen: Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, verlieren wir die Akzeptanz – und damit die Basis für alles Weitere.
Europa kann das noch schaffen. Aber dafür muss es seine Rolle neu definieren: Nicht nur als Käufer auf dem Weltmarkt, sondern als aktiver Mitgestalter einer verantwortungsvollen, widerstandsfähigen Rohstoffversorgung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Der Beitrag Lithium: Rohstoff mit politischer Sprengkraft erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.