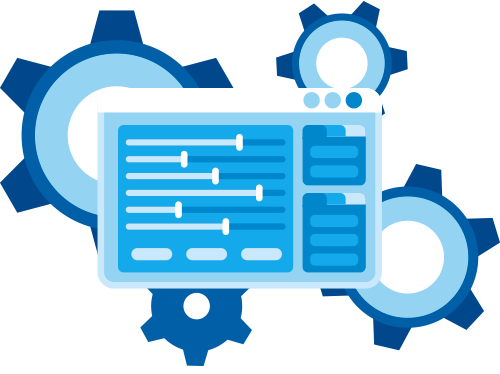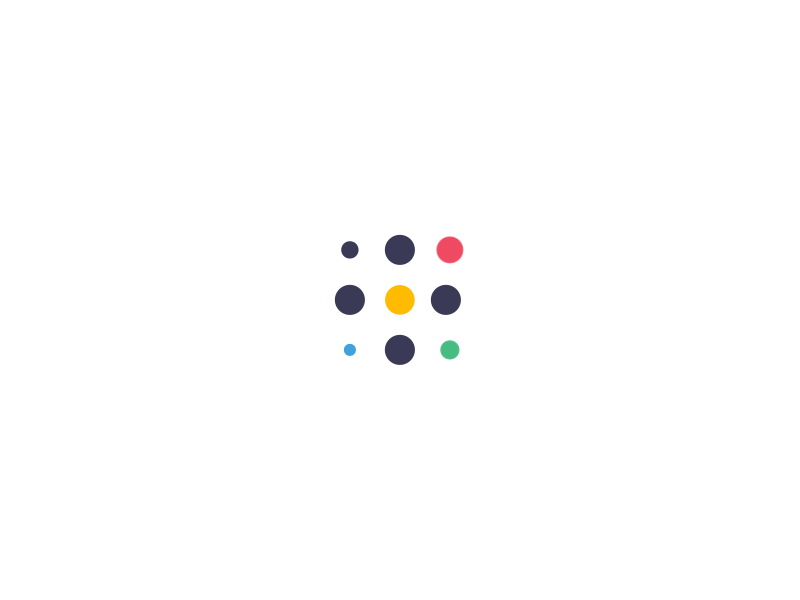Renault baut ein Auto, das CO₂ kaum noch kennt
- Kommentare deaktiviert für Renault baut ein Auto, das CO₂ kaum noch kennt
- Allgemein
Vor wenigen Tagen hatte Elektroauto-News (EAN) die Gelegenheit, der exklusiven Vorstellung des Renault Emblème in Guyancourt bei Paris beizuwohnen. Präsentiert wurde nicht einfach ein weiteres Konzeptfahrzeug, sondern ein ambitioniertes Technologieprojekt, das Renault gemeinsam mit seiner Elektrotochter Ampere und zahlreichen Industriepartnern auf die Räder gestellt hat. Im Zentrum stand dabei ein klar formulierter Anspruch: zu zeigen, wie sich CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Autos hinweg um 90 Prozent verringern lassen – ohne dabei Kompromisse bei Funktion, Design oder Alltagstauglichkeit einzugehen.
Renault | Front des Renault Emblème
Der Emblème ist als rollender Demonstrator konzipiert – nicht als Serienfahrzeug, sondern als technischer Impulsgeber für eine klimaneutrale Mobilität. Bei der Präsentation in Guyancourt wurde deutlich, dass Renault die Dekarbonisierung nicht als abstraktes Ziel begreift, sondern als konkrete Verpflichtung. „Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Zielen treu bleiben. Der Emblème zeigt auf, wie wir diese erreichen möchten“, betonte Cléa Martinet, Vice President Sustainability der Renault Group.
Verringerung der „Cradle-to-Grave“-Emissionen um 62,5 Prozent bis 2030
Die Strategie des Konzerns ist dabei umfassend: Gemessen an den sogenannten „Cradle-to-Grave“-Emissionen (Bezugsjahr 2019) – also unter Einbeziehung von Rohstoffgewinnung, Produktion, Nutzung und Recycling – soll der CO₂-Fußabdruck pro Auto bis 2030 um 62,5 Prozent sinken. Für Europa strebt Renault sogar an, bis 2040 vollständig klimaneutral zu sein. Auf globaler Ebene soll dieses Ziel spätestens 2050 erreicht werden – mit einer Vermeidungsquote von 90 Prozent und maximal 10 Prozent an Kompensationen. Ein erster Schritt wurde bereits 2023 erreicht: Der CO₂-Fußabdruck pro Auto konnte im Vergleich zu 2010 um 28 Prozent gesenkt werden.
Cléa Martinet, Vice President Sustainability der Renault Group
Das Projekt Emblème übersetzt diese Strategie erstmals in ein greifbares Produkt. Pascal Tribotté, Projektleiter für den Emblème, verdeutlichte, wie es dazu kam: „2020 haben wir uns gefragt, was es eigentlich bedeutet, ein Auto mit nahezu null Emissionen zu bauen. Der Emblème ist unsere Antwort auf diese Frage – ein Technologieträger, der es uns erlaubt, zu testen, zu lernen und über unsere Grenzen hinauszuwachsen.“
Renault Emblème: Beispiel einer systemischen Veränderung der Automobilindustrie
Das Besondere am Emblème ist nicht nur seine technische Tiefe, sondern auch der interdisziplinäre Ansatz. In Guyancourt stand der direkte Austausch mit den führenden Köpfen des Projekts im Mittelpunkt – darunter Entwickler, Designer und Technikverantwortliche von Renault, Ampere sowie den beteiligten Partnerunternehmen wie STMicroelectronics, Verkor, ArcelorMittal, Autoneum oder Forvia. Dieser Austausch bildet die Basis für den vorliegenden Bericht, der das Projekt erstmals in seiner ganzen Komplexität abbildet.
Pascal Tribotté, Projektleiter für den Emblème
Dabei wird deutlich: Der Emblème ist nicht nur ein Leuchtturmprojekt der Renault Group, sondern auch ein Beispiel dafür, wie systemische Veränderung in der Automobilindustrie aussehen kann – wenn Technologien, Lieferketten, Design und Nutzerbedürfnisse konsequent auf Klimaziele ausgerichtet werden. Es ist kein Fahrzeug, das in dieser Form auf den Markt kommen wird. Aber es ist ein Auto, das zeigt, wie die Zukunft gebaut werden kann – wenn man bereit ist, neu zu denken. Das wollen wir uns nun ein wenig genauer ansehen.
“Hydrogen-Electric Hybrid” als Kompromiss zwischen geringem CO₂-Fußabdruck und hoher Reichweite
Der Renault Emblème ist ein batterieelektrisches Auto mit einem Brennstoffzellen-Range-Extender – eine Kombination, die nicht nur Effizienz und Reichweite miteinander verbindet, sondern auch einen Beitrag zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks leisten soll. Seitens Renault als “Hydrogen-Electric Hybrid” bezeichnet.
Die Batterie sitzt im Unterboden, hat eine Kapazität von 40 Kilowattstunden und erlaubt laut Renault eine Reichweite von rund 300 Kilometern im Alltag, auf der Autobahn etwa 200 Kilometer. Wird mehr Reichweite benötigt, springt die Brennstoffzelle an – sie liefert kontinuierlich Strom und wird über einen Wasserstofftank mit 2,8 Kilogramm Fassungsvermögen gespeist. Das Ziel: bis zu 1000 Kilometer Gesamtreichweite mit zwei kurzen Tankstopps. Von maximal drei bis vier Minuten Tankpause war die Rede.
Renault | Seitenansicht des Renault Emblème
Die Brennstoffzelle leistet 30 Kilowatt, während der Elektromotor an der Vorderachse 160 Kilowatt abruft. Damit ist der Emblème nicht auf Höchstleistung, sondern auf Effizienz ausgelegt. Auch das Fahrzeuggewicht wurde bewusst niedrig gehalten – mit nur 1800 Kilogramm liegt der Emblème deutlich unter dem vieler heutiger E-Autos ähnlicher Größe. „Wir haben Gewicht eingespart, um effizient zu sein“, erklärte Pascal Tribotté. Die Kombination aus kleinerer Batterie, Brennstoffzelle und aerodynamischer Optimierung erlaubt eine klare Fokussierung auf Reichweite bei gleichzeitig niedrigen Emissionen.
Renault | Getankt wird im Frunk des Stromers
Die Entscheidung für ein Hybridkonzept fiel bewusst gegen den Trend zu immer größeren Batterien. „Wenn man auf eine stärkere Batterie setzt, steigt der CO₂-Footprint in der Herstellung weiter an“, erklärte Cléa Martinet. Der Einsatz einer Brennstoffzelle ermögliche es hingegen, mit einer kleineren Batterie zu arbeiten – was sich in der CO₂-Bilanz deutlich bemerkbar mache. Die Entwicklung sei dabei nicht als kurzfristiger Serienansatz gedacht, sondern als exploratives Konzept: „Vielleicht gibt es noch eine Technologiewende. Vielleicht ersetzt man die Brennstoffzelle durch etwas anderes. Aber was feststeht, ist die Roadmap – und das Ziel, dort anzukommen“, so Tribotté weiter.
Wirksame Lösung statt Technologie-Fetischismus
Zugleich betonte Renault, dass es nicht um Technologie-Fetischismus gehe, sondern um die wirksamste Lösung für bestimmte Anwendungsszenarien. Der Emblème sei besonders dort sinnvoll, wo Reichweite und CO₂-Neutralität zugleich gefragt sei. Der Emissionsvorteil entsteht nicht nur im Betrieb, sondern über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das hybride Antriebskonzept, so Martinet, sei kein Kompromiss, sondern ein strategischer Hebel: „Wir wollten ein Auto ohne Emissionen am Auspuff – deshalb fiel die Wahl auf die Brennstoffzelle.“ Diese Aussage fiel auf die Rückfrage eines Journalisten, warum man den nicht Benzin, Diesel oder E-Fuels anstatt Wasserstoff verwendet.
Renault | Auch das Heck kann sich sehen lassen
Auch wenn der Emblème nicht in Serie gehen wird, sollen Elemente des Antriebsstrangs in kommenden Modellen Verwendung finden. Der Mix aus Batterie und Wasserstoff sei technisch anspruchsvoll, aber zukunftsgerichtet – vorausgesetzt, Infrastruktur und Skalierung schreiten voran. Renault denkt hier in Baukastenlogik: Was sich bewährt, wird übernommen. Was nicht skalierbar ist, bleibt ein wertvoller Erkenntnisbaustein. Oder wie Cléa Martinet es formulierte: „Wenn du das nicht ganz zu Ende baust, lernst du nicht tief genug.“
CO₂-Reduktion im Lebenszyklus: Systematische Analyse
Wer über Dekarbonisierung im Automobilbau spricht, muss den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs in den Blick nehmen. Renault wählt für seine Berechnungen das Cradle-to-Grave-Prinzip, das sämtliche Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum Ende der Nutzung umfasst – gemessen über eine Laufleistung von 200.000 Kilometern. Beim Emblème strebt der Konzern eine Senkung des CO₂-Fußabdrucks um 90 Prozent an. Dieses Ziel markiert eine neue Dimension – und offenbart zugleich die Komplexität des Vorhabens.
„Wenn man auf Elektroantrieb umstellt, spart man nur etwa die Hälfte der Emissionen ein“, erklärte Cléa Martinet während der Präsentation. Der Hauptfaktor ist nicht der Antrieb selbst, sondern der Strommix – also die Frage, mit welcher Energie das Auto betrieben wird. Kommt fossile Energie zum Einsatz, relativiert sich der Vorteil schnell. Daher arbeitet Renault nicht nur an effizienteren E-Autos, sondern auch daran, den Strombedarf insgesamt zu senken.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Batteriegröße. Große Batterien ermöglichen hohe Reichweiten, erhöhen aber auch den CO₂-Fußabdruck in der Produktion. „Je stärker die Batterie, desto größer der CO₂-Footprint“, betonte Martinet. Der Emblème setzt daher auf eine kleinere Batterie mit Range Extender – was im Lebenszyklus bis zu vier Tonnen CO₂ spart. Materialwahl und Gewicht spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. So können durch den Einsatz optimierter Werkstoffe weitere sieben Tonnen CO₂ eingespart werden.
Renault hat diese Einflussfaktoren in sieben zentrale Material- und Technologiebereiche unterteilt, die gemeinsam für über 90 Prozent der gesamten Fahrzeugemissionen verantwortlich sind: Batterie, Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Reifen, Elektronik sowie Brennstoffzelle und Wasserstoffspeicher. In jedem dieser Bereiche wurden beim Emblème konkrete Reduktionsziele formuliert – etwa 70 Prozent CO₂-Einsparung pro Komponente sowie ein Rezyklatanteil von mindestens 50 Prozent.
Diese ambitionierten Werte lassen sich nur in enger Zusammenarbeit mit den Zulieferern erreichen. „Ohne das Mitwirken der Partner ist Dekarbonisierung im Autosektor nicht möglich“, so Martinet. Renault hat im Rahmen des Projekts nicht nur technische Spezifikationen vorgegeben, sondern auch Transparenz bei Emissionswerten und Lebenszyklusanalysen eingefordert – ein Schritt, der in der Industrie keineswegs selbstverständlich ist.
Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass der Weg zur Klimaneutralität keine Einbahnstraße ist. „Wenn du mehr Effizienz willst, musst du verstehen, wo dein Hebel liegt“, so Tribotté. Beim Emblème wurden die Hebel identifiziert und durchgerechnet – vom Materialeinsatz über den Produktionsprozess bis hin zur Nutzung und zum Recycling. Die Ergebnisse sind nicht nur relevant für dieses eine Fahrzeug, sondern bilden die Grundlage für eine neue Generation von CO₂-optimierten Modellen, die in den kommenden Jahren in Serie gehen sollen.
Renault setzt auf Simulation als Schlüssel zur Dekarbonisierung
Hieran schließt sich auch die Erkenntnis an, dass ein zentrales Element des Emblème-Projekts die konsequente Nutzung digitaler Entwicklungs- und Simulationsmethoden ist. Renault versteht den virtuellen Raum längst nicht mehr nur als Hilfsmittel, sondern als Rückgrat eines neuen Verständnisses von Fahrzeugentwicklung. Der Emblème wurde größtenteils digital geplant, getestet und optimiert – mit dem Ziel, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Ressourcen zu schonen und Emissionen zu senken.
„Das Projekt lebt von der Frage: Wie kann ich Technologie effizient und ressourcenschonend in ein Produkt übersetzen?“, so Pascal Tribotté. Die Antwort liegt für Renault in einem dreistufigen Ansatz: Zunächst werden Entwicklung, Test und Validierung so weit wie möglich im virtuellen Raum abgebildet – reale Prototypen werden dadurch weitgehend ersetzt. Zweitens ermöglicht diese Herangehensweise eine zügige Implementierung von Verbesserungen. Drittens unterstützt die digitale Simulation die Dekarbonisierung, da Emissionen über den gesamten Produktzyklus hinweg erfasst und gezielt reduziert werden können.
Dieser umfassende digitale Ansatz erlaubt es Renault, technische Zielkonflikte frühzeitig zu erkennen und zu bewerten – etwa zwischen CO₂-Bilanz, Reichweite, Komfort und Kosten. So wurden im Projektverlauf unzählige Parameter durchgespielt: die Größe der Batterie, das Verhalten der Brennstoffzelle im Langstreckenbetrieb, die Effizienz einzelner Materialien oder die Integration der Elektronik. „Das Ziel war nicht Perfektion, sondern Erkenntnisgewinn“, betonte Tribotté während der Präsentation.
Einbindung der Zulieferer macht den Unterschied beim Senken des CO₂-Fußabdrucks
Auch im Austausch mit den beteiligten Partnern zeigte sich die Stärke des virtuellen Entwicklungsprozesses. Zulieferer wie Verkor, STMicroelectronics oder ArcelorMittal konnten ihre Lösungen frühzeitig in die digitale Fahrzeugarchitektur einbringen – sei es bei der Integration des Inverters, der Batterie oder neuer Stahllegierungen. Dies beschleunigt nicht nur die Zusammenarbeit, sondern fördert auch eine ganzheitliche Systemoptimierung.
Dabei bleibt das virtuelle Arbeiten kein rein technisches Thema. Cléa Martinet verwies auf die strategische Dimension der Digitalisierung: „Durch mehr Effizienz kommt weniger Energie im Straßenverkehr zum Einsatz – dadurch lassen sich bis zu fünf Tonnen CO₂ über den Lebenszyklus eines Autos einsparen.“ Die Simulation wird so zum Hebel für emissionsärmere Mobilität – nicht nur in der Entwicklung, sondern auch im Betrieb.
Renault geht davon aus, dass bis zu 75 Prozent aller zukünftigen Fahrzeugtests virtuell stattfinden können. Der Emblème zeigt exemplarisch, wie weitreichend diese Verschiebung bereits möglich ist – und wie sie dazu beiträgt, den CO₂-Fußabdruck eines Autos von Anfang an aktiv zu gestalten. „Das spart nicht nur Zeit, sondern auch viele Emissionen, die sonst in Prototypen und Testflotten stecken würden“, so Tribotté abschließend.
Sieben Hebel zur CO₂-Senkung – aus der Simulation in die Realität
Ein zentraler Baustein des Emblème-Projekts ist die gezielte Steuerung des Materialeinsatzes – nicht nur in Bezug auf Leichtbau oder Design, sondern mit Blick auf die CO₂-Bilanz. Renault identifiziert sieben zentrale Materialgruppen, wie eingangs bereits erwähnt, die gemeinsam für über 90 Prozent der Emissionen eines Autos verantwortlich sind: Batterie, Stahl, Aluminium, Polymere, Elektronik, Reifen sowie das Wasserstoffsystem bestehend aus Brennstoffzelle und Tank. Jeder dieser Bereiche birgt spezifische Herausforderungen – aber auch konkrete Einsparpotenziale.
„Wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, müssen wir dort ansetzen, wo der größte Hebel liegt“, erklärte Cléa Martinet. Renault hat deshalb im Emblème-Projekt für jede Materialkategorie eigene Strategien entwickelt – mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen pro Bauteil um 70 Prozent zu senken. Gleichzeitig soll künftig die Hälfte aller Materialien aus recycelten Quellen stammen.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Batterie. Sie ist der mit Abstand größte Einzelverursacher von CO₂ im Auto – vor allem wegen der energieintensiven Herstellung der Zellen. Renault arbeitet hier mit dem französischen Hersteller Verkor zusammen. Gemeinsam entwickelt man eine Batteriezellfertigung, die auf erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft und kurze Lieferketten setzt. „Unser Ziel ist es, den CO₂-Ausstoß pro Kilowattstunde von über 100 auf etwa 30 Kilogramm zu senken“, erklärte Benjamin Reynoud, Key Account Manager von Verkor. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf Abwärmenutzung aus der umliegenden Industrie für die eigenen Produktionsprozesse, recycelte Materialien und digitale Prozessoptimierung.
Forvia Faurecia zeigt Materialien, die im Technologieträger zum Einsatz kommen
Auch im Bereich Stahl verfolgt Renault ambitionierte Ziele. Gemeinsam mit ArcelorMittal wurde eine CO₂-Reduktion von 69 Prozent bei den Karosserieblechen erreicht. Grundlage dafür ist die Umstellung auf Elektrolichtbogenöfen, die Nutzung von Direktreduktion mit Erdgas und perspektivisch mit Wasserstoff sowie ein Rezyklatanteil von 54 Prozent. „Stahl ist nicht das Problem – solange wir ihn richtig produzieren“, betonte Sarah Snellinx, Head of Sustainability for Automotive, Packaging and Electrical Steels von ArcelorMittal.
Für das Aluminium im Emblème setzt Renault auf die Expertise von Constellium. Das Unternehmen kombiniert konventionelles Primäraluminium mit Pre-Consumer- und Post-Consumer-Rezyklat, um den CO₂-Ausstoß von acht auf nur noch 2,4 Tonnen pro Tonne Aluminium zu senken – ein Minus von 70 Prozent. „Es kommt darauf an, woher das Aluminium stammt – und wie es geschmolzen wird“, erklärte Andreas Afseth, Technischer Direktor bei Constellium.
Unschlagbare Erkenntnis: Am meisten CO₂ spart man durch bloßen Verzicht ein!
Im Bereich Kunststoffe spielen sowohl Materialauswahl als auch Monomaterialstrategien eine Rolle. So liefert Autoneum für den Emblème einen vollständig recycelbaren Teppich aus 100 Prozent Polyester, davon 90 Prozent Rezyklat im Einsatz. Forvia wiederum setzt im Innenraum auf biobasierte und recycelte Polymere, die sowohl strukturelle als auch dekorative Funktionen übernehmen. Ziel ist ein Rezyklatanteil von über 80 Prozent – bei gleichzeitig reduzierter Teilezahl.
Blick auf Materialien von Autoneum
Elektronische Komponenten wie der Traction Inverter von STMicroelectronics tragen ebenfalls zur Dekarbonisierung bei – nicht nur durch effizienten Betrieb, sondern auch durch CO₂-arme Fertigung. „Wir konnten die Emissionen unserer Power-Module und Mikrocontroller im Vergleich zu 2018 um rund 80 Prozent senken“, erklärte Cristiana Ciaraldi, Head of Sustainability (EMEA) bei STMicroelectronics. Basis dafür ist der konsequente Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Abkehr von klimaschädlichen Prozessgasen als auch eine gesteigerte Ressourceneffizienz.
Auch bei den Reifen und dem Wasserstoffsystem wurde auf CO₂-reduzierte Lösungen gesetzt. Der Wasserstofftank des Emblème wurde so gestaltet, dass er maximale Effizienz bei minimalem Gewicht erreicht. Die Brennstoffzelle arbeitet mit einem Wirkungsgrad, der die Batterie systemisch entlastet und so indirekt zur Senkung des Gesamt-Fußabdrucks beiträgt.
Am Ende steht ein klarer Befund: Materialfragen sind Klimafragen. Der Emblème zeigt, wie sich über alle relevanten Komponenten hinweg CO₂ einsparen lässt – vorausgesetzt, Hersteller und Partner ziehen an einem Strang. „Dekarbonisierung ist kein Solo – sie ist Teamarbeit entlang der gesamten Lieferkette“, fasste Cléa Martinet zusammen. Und doch beginnt diese Teamarbeit oft mit einer einfachen Entscheidung: nämlich auf das zu verzichten, was nicht unbedingt nötig ist. Oder wie es Benoît Taillandier von Forvia formulierte: „Ein gutes Kilogramm ist ein Kilogramm, das man gar nicht erst ins Auto einbringt.“
Effizienz beginnt mit der Form – wie Renault Design und Aerodynamik neu kombiniert
Beim Renault Emblème ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage von Antrieb und Material, sondern tief in der äußeren und inneren Gestaltung verankert. Exterieur und Interieur folgen einer klaren Philosophie: maximale Effizienz bei minimalem Ressourcenaufwand. Statt auf visuelle Übertreibung setzt Renault auf durchdachte Einfachheit – ein Prinzip, das sich in jeder Linie, jedem Bauteil und jedem Material wiederfindet.
„Wir haben sehr viel am Exterieur gearbeitet, um die Effizienz zu steigern“, erklärte Matthieu Lemmonier, Fahrzeugarchitektur-Ingenieur bei Renault. Im Mittelpunkt steht dabei ein aktiver Frontgrill, der sich automatisch an die Umgebung anpasst, sowie eine bewusst abgesenkte Linienführung an der Front. Türgriffe und Sensoren sind flächenbündig integriert, klassische Außenspiegel wurden durch Kameras ersetzt. „Es ging uns darum, jede unnötige Störung im Luftfluss zu vermeiden“, so Lemmonier.
Auch das scheinbare Heckfenster ist Ausdruck dieser Effizienzlogik: Es wirkt wie ein Sichtfenster, erfüllt aber vor allem eine aerodynamische Funktion. Die Rückfahrkamera ist dezent darin eingebettet. Eine aktive Luftführung im Heckbereich verbessert den Luftstrom zusätzlich – ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Gleichzeitig erlaubt das reduzierte Layout eine großzügige Kofferraumöffnung mit 550 Litern Ladevolumen bis zur Unterkante.
Ein weiteres funktionales Designelement ist die Solarpaneel-Fläche auf dem Dach, die sich bis in den Spoiler erstreckt. Sie speist nur bedingt den Antrieb, übernimmt vor allem die Aufgaben der Bordstromversorgung. „Natürlich reicht das nicht, um das Auto zu laden“, betonte François Farion, Design Director für Innovation, Nachhaltigkeit und Materialien bei Renault. „Aber es spart Energie – und sendet eine starke visuelle Botschaft.“
Auch bei der Lackierung stand Ressourcenschonung im Vordergrund. Die Farbe „Eclipse Green“ wechselt je nach Blickwinkel von Blau zu Grün. Gleichzeitig kommt ein neu entwickeltes Verfahren zum Einsatz, das weniger thermische Energie benötigt und den CO₂-Ausstoß in der Produktion senkt. Hier zeigt sich: Auch scheinbar rein ästhetische Entscheidungen können eine ökologische Wirkung entfalten.
Im Innenraum setzt Renault auf eine radikale Reduktion der Elemente. Tasten wurden weitgehend durch Touchflächen ersetzt, etwa an den Sitzen. Das Lenkrad ist minimalistisch gehalten, die Rückbank als durchgängiges, komfortorientiertes Sofa gestaltet. „Alles, was man nicht unterbringen muss, muss man auch nicht reduzieren“, so Lemmonier. Der Innenraum verzichtet nicht auf Komfort – er definiert ihn neu, wie man uns zu verstehen gibt.
Besonders sichtbar wird die Nachhaltigkeitsstrategie in der Materialwahl. Das Dashboard besteht aus Flachs, der zu 90 Prozent aus französischer und belgischer Produktion stammt und ohne Kunststoffträger auskommt. Der Bodenbelag besteht zu 95 Prozent aus recycelten Fasern. Für die Sitzbezüge werden ausschließlich recycelte PET-Fasern verwendet. Jeder Werkstoff wurde dabei nicht nur auf CO₂-Wirkung, sondern auch auf seine Gestaltungsqualität hin ausgewählt.
Das Interieur folgt einem Eco-Design-Ansatz, der Bauteile verschlankt, monomaterialfähig gestaltet und auf modulare Wiederverwendbarkeit hin optimiert ist. Displays und Bedienelemente sind hinter dekorativen Oberflächen verborgen und erscheinen nur bei Bedarf. Das reduziert sowohl die visuelle Komplexität als auch die kognitive Belastung während der Fahrt.
Spätestens nach dem Austausch mit den beiden Design- und Material-Experten ist klar: Design ist beim Emblème keine oberflächliche Hülle, sondern ein funktionales Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Jeder Griff, jede Fläche, jede Faser zahlt auf das große Ziel ein: weniger Emissionen, ohne auf Identität zu verzichten.
Renault Emblème: Impulsgeber auf dem Weg in eine CO₂-ärmere Zukunft
Der Renault Emblème wird in dieser Form nicht auf die Straße kommen. Das haben Cléa Martinet und Pascal Tribotté bei der Präsentation nahe Paris unmissverständlich deutlich gemacht. Und doch steht das Konzeptfahrzeug im Zentrum einer strategischen Weichenstellung: Der Emblème ist kein Serienmodell, sondern ein Technologieträger – ein Projekt, das zeigen soll, was technisch möglich und was im industriellen Maßstab denkbar ist.
„Das Fahrzeug an sich wird so erst einmal nicht kommen“, sagte Martinet. „Aber wir sehen hier verschiedene Bausteine, die sich in die Serie übertragen lassen.“ Dazu zählen etwa der Einsatz recycelter Materialien, die modulare Innenraumarchitektur, CO₂-reduzierte Stahl- und Aluminiumlösungen oder das hybride Antriebskonzept mit Wasserstoff-Range-Extender. Allesamt Technologien, die bereits jetzt in Serienprojekten geprüft oder sogar integriert werden.
Die Erkenntnisse aus dem Emblème-Projekt sollen dabei nicht nur Renault selbst, sondern auch den Zulieferern helfen, ihre Prozesse und Produkte klimafreundlicher aufzustellen. Renault setzt bewusst auf ein offenes Ökosystem: Innovationen entstehen nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in der Zusammenarbeit mit Partnern – entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie wir selbst erfahren konnten. Der Emblème fungiert in diesem Sinne als Beschleuniger für gemeinsames Lernen. Auch in die Unternehmen hinein.
Doch so ambitioniert die Ziele auch sind – der Weg in die breite Anwendung bleibt herausfordernd. Ein Beispiel ist die Kostenfrage: Das hybride Antriebssystem mit Brennstoffzelle und Batterie sei heute noch teurer als eine große Batterie allein. „In Serie könnte es gleichauf sein – das hängt von der Skalierung ab“, erklärte Tribotté. Hier treffen Technologie, Marktlogik und Infrastruktur aufeinander – nicht alle Fragen lassen sich im Entwicklungszentrum lösen.
Auch zur politischen Diskussion rund um synthetische Kraftstoffe und Plug-in-Hybride bezog Martinet klar Stellung: „In Verbindung mit Diesel, Benzin oder E-Fuels würde ein solches Fahrzeug funktionieren – aber dann würden eben CO₂-Emissionen entstehen. Und das wollen wir nicht.“ Die Zielsetzung bleibt konsequent auf Vermeidung ausgerichtet – nicht auf Kompensation oder technologische Umgehung.
Trotz aller Restriktionen bleibt der Emblème ein Projekt mit hoher Strahlkraft. Er markiert den Versuch, Emissionen nicht am Auspuff, sondern an der Wurzel zu bekämpfen. Renault hat gezeigt, dass Dekarbonisierung nicht bei der Energiequelle aufhört – sondern im Material, im Design, in der Entwicklung und in der Lieferkette beginnt.
Damit wird klar: Der Emblème ist kein Ziel, sondern ein Ausgangspunkt.
Disclaimer: Renault hat zum Kennenlernen des Renault Emblème nach Paris eingeladen und hierfür die Reisekosten übernommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere hier geschriebene ehrliche Meinung.
Der Beitrag Renault baut ein Auto, das CO₂ kaum noch kennt erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.